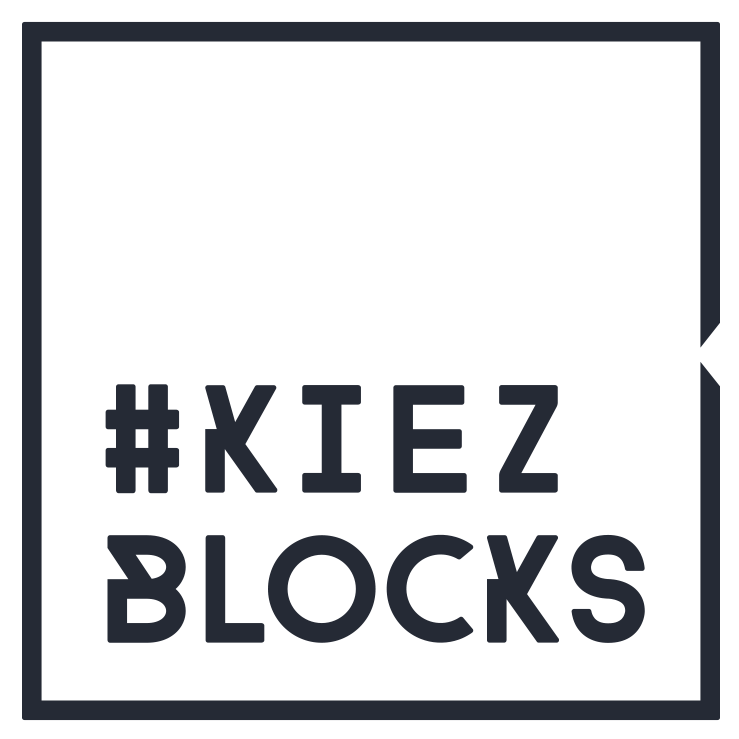Ein Interview mit Levke Sönksen vom Deutschen Institut für Urbanistik.
Wir durften Levke Sönksen aus dem Forschungsbereich Mobilität des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) interviewen. Sie ist Mitherausgeberin des neuen Policy Papers “Verkehrsberuhigung und Einzelhandel: Dann wird’s laut”. Aber – was steht da eigentlich drin?
Julia Janßen, Changing Cities: Danke, dass Du Dir Zeit genommen hast. Du bist die Autorin eines Papers – wer ist das DiFu und worum geht es?
L. Sönksen: Wir sind ein Stadtforschungsinstitut, was sehr praxis angewandte Forschung macht – für und mit Kommunen. In dem Zuge haben wir ein Policy Paper herausgebracht. Es heißt “Verkehrsberuhigung und Einzelhandel: Dann wird’s laut”. Die Idee der Policy Papers ist immer, relevante Themen für Kommunen aufzuarbeiten und mit praktischen Handlungsempfehlungen anzureichern, damit genau die dann auch in die kommunale Praxis überführt werden können. Leitfrage soll also auch sein: Was können wir jetzt mit diesen Informationen anfangen?
| „Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Schaden dem Einzelhandel per se nicht. Im Gegenteil, dort, wo sie gut umgesetzt sind, können sie zu positiven Entwicklungen führen„ |
CC: Was sind die zentralen Erkenntnisse aus dem Paper, mit denen Ihr in die Praxis gehen wollt?
L. Sönksen: Die zentrale Erkenntnis ist, dass Verkehrsberuhigungsmaßnahmen per se nicht dem Einzelhandel schaden. Im Gegenteil, dort, wo sie gut umgesetzt sind, können sie zu positiven Entwicklungen führen der zumindest bleiben die Umsätze gleich. Und wenn wir uns den strukturellen Wandel im Einzelhandel anschauen, dann ist gleichbleibend tatsächlich schon positiv zu bewerten.
CC: Es gibt ja den Mythos: Wenn die Parkplätze weg sind, bleiben auch die Kund*innen weg. Was sagst Du dazu?
L. Sönksen: Die Studien, die wir uns angeschaut haben, zeigen ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, nur weil Parkplätze wegfallen, fallen nicht auch die Umsätze. Im Gegenteil sehen wir sogar, dass die Umsätze steigen können oder zumindest gleich bleiben. Das liegt daran, dass Pkw-Fahrer*innen pro Einkauf zwar einen höheren Umsatz generieren, aber dafür auch weniger regelmäßig vor Ort sind, als diejenigen, die mit dem Umweltverbund (A. d. R Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr) anreisen. Wir sehen außerdem, dass Händler*innen oftmals überschätzen, wie viele ihrer Kund*innen mit dem Auto anreisen, wie viel Umsatz diese generieren und auch die Distanzen, die von den Menschen zurückgelegt werden, um das Geschäft zu erreichen. Das heißt, die Händler*innen nehmen eine stärkere Auto-Abhängigkeit wahr, als sie tatsächlich laut Studien gegeben ist. Wir glauben, dass der Parkplatz hier eine Stellvertreterrolle für Erreichbarkeit einnimmt, dass Parkplatz und Erreichbarkeit gleichgesetzt werden. Erreichbarkeit ist aber eben gerade in Großstädten nicht nur oder mit am wenigsten über den Pkw gegeben, sondern vor allem über/durch den Umweltverbund. In der Konsequenz spricht das eigentlich für den Ausbau des Umweltverbundes.
| „Wir wollen Erreichbarkeit schaffen und dabei eben alle mitdenken.„ |
Und wenn wir über Erreichbarkeit sprechen, müssen wir auch den Lieferverkehr mitdenken, sowie mobilitätseingeschränkte Personen, Elternteile mit Kinderwagen und so weiter. Und genau das wird ja eigentlich fast immer bei den Planungen gemacht. Oft geht es um das Argument, wenn das Auto verboten wird, kann die Innenstadt nicht mehr erreicht werden – aber genau das ist ja nicht der Fall. Hier muss ich aber auf jeden Fall erwähnen, dass sich unsere Ergebnisse vor allem auf Großstädte stützen, da es für kleinere und mittlere Städte leider deutlich weniger oder gar keine belastbaren Daten gibt.
CC: Was hat Dich dazu gebracht, Dich mit dem Zusammenhang zwischen Verkehrsberuhigung und Einzelhandel zu beschäftigen?
L. Sönksen: Die Idee für unser Paper ist entstanden, weil Kommunen bei Themen wie Klimaschutz, Aufenthaltsqualität und Einzelhandel oft in einer echten Zwickmühle stecken. Die Debatten dazu werden schnell emotional – und genau da wollten wir ansetzen: Vorhandene Infos zusammentragen, die Karten auf den Tisch legen und so helfen, das Ganze sachlicher anzugehen. Es geht nicht darum, bestimmte Argumente durchzudrücken, sondern Kommunen Hinweise an die Hand zu geben, worauf sie achten können, damit Maßnahmen vor Ort möglichst gut funktionieren – auch mit Blick auf den Einzelhandel.
CC: Gibt es denn in Eurer Recherche etwas, das Dich überrascht hat?
L. Sönksen: Überrascht nicht direkt, aber sie hat nochmal sehr stark dafür sensibilisiert, wie vielfältig die Herausforderungen des Einzelhandels gerade sind. Da geht es um Strukturwandel, um Onlinehandel, um Probleme mit Nachfolger*innen – viele Herausforderungen, und das Parkplatzthema ist nur eines von Vielen. Ich habe aber auch ganz stark wahrgenommen, wie viel Potenzial darin steckt, den Einzelhandel mit an Bord zu holen – weil wir in den Ergebnissen sehen, dass der Einzelhandel profitieren kann. Das wird vom Einzelhandel aber gerade leider nicht immer so wahrgenommen, sondern das Gegeneinander dominiert den Diskurs. Wenn da die Allianzen erstmal gefunden und etabliert werden können, dann hat das ganz viel Potenzial auch für die Umgestaltung von Innenstädten. Das ist das Zentrale, dieses Gegeneinander irgendwie aufzuheben und zu einem Miteinander zu kommen. Das ist herausfordernd, aber auch sehr vielversprechend.
CC: Zum Schluss: Wenn Du den kommunalen Entscheider*innen was mit auf den Weg geben könntest, was wäre Dein wichtigster Rat?
L. Sönksen: Gar nicht so leicht, ohne zu platt zu lingen. Aber im Grunde: Verliert nicht den Mut und das Zentrale ist die Kommunikation! Es geht nicht darum, etwas wegzunehmen, sondern etwas zu schaffen – und zwar nicht nur Kleinigkeiten, sondern Aufenthaltsqualität, Gesundheitsschutz, Klimaanpassung. Unser Ziel ist es ja nicht nur in kurzfristigen Maßnahmen zu denken, sondern langfristige Visionen zu entwickeln: Wie wollen wir unsere Städte gestalten, Straßenräume neu aufteilen und Platz für mehr Grün und Lebensqualität schaffen.